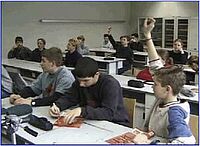Basismodelle des Experimentierens
Schlagworte:
-Anwenden der Oserschen Theorie auf Unterricht mit Experimenten
-Entwicklung von Handlungskettenschritten
Mit dem Experimentieren werden im naturwissenschaftlichen Unterricht vielfältige Ziele verfolgt und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern angestrebt. Zugleich zeigt die Forschung sehr eindrücklich, dass die Wirksamkeit von experimentellem Unterricht hinter den Erwartungen zurückbleibt. Unseres Erachtens liegen Ursachen dafür zum einen in zu vielfältigen Zielsetzungen und zum anderen in einer fehlenden Fokussierung auf die Funktion eines Experiments für den Lernprozess. Es fehlt bspw. ein praxistaugliches Modell für die Lehrkräfte, das die unterschiedlichen Funktionen des Experimentierens und die dazu bekannten Forschungsergebnisse in die Unterrichtspraxis überführt.
Wir stellen einen Ansatz vor, wie dieses Problem angegangen werden kann, indem mittels eines vorhandenen Modells des Unterrichtens (Basismodelle von Oser) die direkte Anwendbarkeit fachdidaktischer Forschung auf die Unterrichtspraxis aufgezeigt wird.
60-Minuten im Physikunterricht
-Untersuchung des Lernprozessabschlusses durch Unterrichtsstundenverlängerung
Obwohl bislang keine theoretischen Arbeiten und nur wenige empirische Untersuchungen zur optimalen zeitlichen Strukturierung von Unterricht vorliegen, verlängern einige Schulen in Deutschland z. Zt. die Schulstundenlänge auf 60 Minuten. Damit wird das Ziel verfolgt, die Unterrichtsqualität zu verbessern. Die beantragte empirische Studie möchte die unterstellte Wirksamkeit dieser Stundenverlängerung exemplarisch anhand von Physikunterricht prüfen. Dazu wird der 60-Minuten-Unterricht von vier Physiklehrkräften aufgezeichnet und ausgewertet und mit dem 45-Minuten-Unterricht der gleichen Lehrkräfte aus einer bereits abgeschlossenen Studie verglichen. Die Analyse und Bewertung erfolgt unter dem Blickwinkel der Basismodelle nach Oser. Ergänzend dazu erfolgen eine Schülerbefragung und ein Expertenrating. Die Studie möchte erste Hinweise liefern, inwiefern die zeitliche Umstellung allein schon Effekte auf die Unterrichtsqualität hat und ob nicht noch zusätzliche Maßnahmen wie Schulungen der Lehrkräfte zur gezielten Nutzung dieser Zeit notwendig sind.